Diese Recherche ist in Zusammenarbeit mit der Investigativ-Plattform DOSSIER entstanden
In Österreich leben 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen. So steht es auf der Website des Österreichischen Behinderten-Rats. Die Zahl ist das Ergebnis einer Umfrage der Statistik Austria. Sie hat 2015 zwei Fragen gestellt: »Sind Sie im Alltagsleben aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eingeschränkt?« Und: »Haben Sie diese Beeinträchtigung schon länger als ein halbes Jahr?« Diese Fragen orientieren sich daran, wie Behinderung in vielen österreichischen Gesetzen definiert ist. 18,4 Prozent der Befragten haben beide Fragen mit Ja beantwortet. Das bedeutet: Mehr als jede sechste Person gab an, eine Behinderung zu haben.
Es sind also viele Menschen betroffen. Menschen, über die wir wenig wissen. Denn die Datenlage zu Menschen mit Behinderungen ist schlecht. Das liegt auch daran, dass nicht einheitlich festgelegt ist, was der Begriff Behinderung überhaupt bedeutet. Die Frage wird in Interessen-Vertretungen und in der Wissenschaft intensiv diskutiert. Auch in Österreichs Gesetzen gibt es verschiedene Begriffs-Erklärungen. Wer ist also gemeint, wenn von Menschen mit Behinderungen die Rede ist?
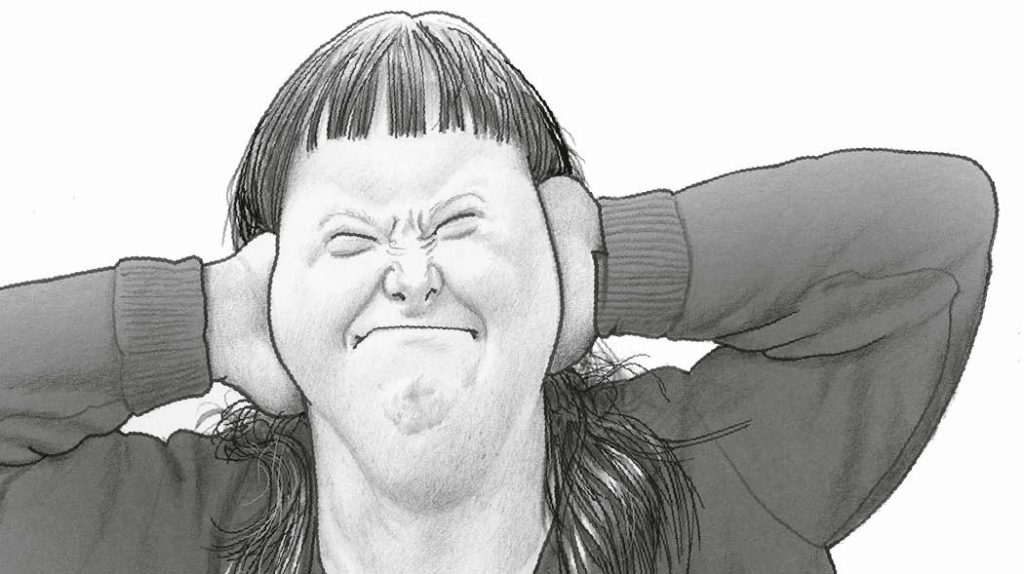
Der kostenlose Newsletter für alle, die Behinderung besser verstehen wollen!
Die Zahl der Statistik Austria ist am Ende eine Schätzung. Denn 2015 wurden nur Menschen über 14 Jahre befragt, die in ihrem eigenen Zuhause leben. Die Befragung wurde telefonisch durchgeführt. Gehörlose Menschen waren dadurch zum Beispiel automatisch ausgeschlossen. Menschen in Wohn-, Alters- und Pflegeheimen auch. Dort leben besonders viele Menschen mit Behinderungen. Und trotzdem ist es für den Behinderten-Rat die verlässlichste Zahl, die es heute gibt.
Fest steht: Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist vielfältig. So nutzt etwa nur eine von 200 Personen in Österreich einen Rollstuhl. Aber schon eine von sieben Personen ist in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Außerdem gibt es viele weitere Formen von Behinderungen. Zum Beispiel Menschen mit Lern-, Hör- und Sehbehinderungen und mit psychischen Behinderungen. Aber wo fängt Behinderung an? Und wo hört sie auf?
Die Antwort hängt davon ab, welches Modell von Behinderung man verwendet. Beim medizinischen Modell wird Behinderung an Diagnosen und Symptomen festgemacht. Es geht also darum, was jemand nicht kann. Mit der Unterzeichnung der Behindertenrechts-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich Österreich aber zu einem anderen Verständnis von Behinderung verpflichtet. Es basiert auf dem sozialen Modell von Behinderung und besagt: Behinderung entsteht, weil es Barrieren und Ausschluss gibt. Sie verhindern die Teilhabe. Menschen sind also nicht behindert, sie werden behindert.
In Schubladen gesteckt
Dennoch wird in Österreichs Gesetzen weiterhin auch das medizinische Modell angewendet. Denn eine Behinderung muss meist anerkannt werden, um Unterstützung zu bekommen. Hier kommt der sogenannte Grad der Behinderung ins Spiel. Dieser Grad ist laut Gesetz von der »Art und Schwere der Funktions-Beeinträchtigung« abhängig. Und darüber entscheidet eine Behörde des Sozial-Ministeriums: das Sozial-Ministerium-Service. Die Höhe des Grades hängt von Diagnosen und Symptomen ab. Das bedeutet: Betroffene werden untersucht und müssen Befunde von Ärzt·innen vorlegen.
Für viele staatliche Unterstützungen braucht es einen Behinderungs-Grad von mindestens 50 Prozent. Etwa um einen Behinderten-Pass zu bekommen. Mit ihm kann man zum Beispiel in Wien eine höhere Mindestsicherung beantragen. Auch als »begünstigt behindert« gelten nur Menschen mit einem Behinderungs-Grad ab 50 Prozent. Und auch dafür muss ein eigener Antrag gestellt werden. Manche Unterstützung in der Arbeit gibt es nur für begünstigte behinderte Menschen. Die Folge: Es gibt ein »nicht behindert genug« und ein »zu behindert«. Die einen haben einen Grad der Behinderung unter 50 Prozent – und bekommen deshalb weniger Unterstützung. Andere werden aufgrund ihrer Behinderung als »arbeitsunfähig« eingestuft, obwohl sie sich eine Arbeit zutrauen und sogar wünschen würden.
Auch im aktuellen Nationalen Aktionsplan Behinderung wird das medizinische Modell infrage gestellt. In diesem Plan hat die Bundes-Regierung festgelegt, was sie für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen tun will. Darin steht auch an mehr als zehn Stellen, wie schlecht die Datenlage ist. Sie soll laut Plan etwa bei Kindern, Jugendlichen, Frauen, Migrant·innen und älteren Menschen mit Behinderungen verbessert werden.
Du glaubst an unsere Vision von inklusivem Journalismus? Dann unterstütze uns mit einem Abo!
Ein Beispiel, das das Datenproblem erklärt: Wie viele Menschen mit Behinderungen waren 2021 arbeitslos? Zahlen dazu gibt es vom Sozial-Ministerium-Service (SMS) und vom Arbeitsmarkt-Service (AMS). Das SMS zählt dafür nur begünstigte behinderte Menschen.
Ende 2021 waren es rund 126 Tausend. Rund 62.000 von ihnen haben nicht gearbeitet, also etwa die Hälfte. Das AMS hingegen arbeitet mit dem Begriff »gesundheitliche Vermittlungs-Einschränkungen«. Zu dieser Gruppe wurden 2021 im Durchschnitt 92.000 Menschen gezählt. Sie haben durch Ärzt·innen bestätigen lassen, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben. Rund 15.000 von ihnen hatten anerkannte Behinderungen. Also zum Beispiel Personen mit einem Behinderten-Pass.
Und dann gibt es noch etwa 28.000 Personen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Sie gelten rechtlich nicht als erwerbstätig – also nicht als Menschen, die arbeiten. Aber als arbeitslos werden sie auch nicht gezählt. Denn dafür müssen sie »arbeitsfähig« sein. Das sind sie offiziell nicht. Jede Zählweise zeigt also nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Er ist davon beeinflusst, was unter dem Begriff Behinderung verstanden wird. Und das ist letztlich eine politische Frage.
- November, 2023
Geschrieben Von
Emilia Garbsch
In Zusammenarbeit mit
DOSSIER
Redaktion
Lisa Kreutzer
Inklusiver, kritischer und gleichberechtigter Journalismus ist wertvoll
andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Bei uns arbeiten Journalist*innen mit und ohne Behinderung gemeinsam – damit wir unabhängig bleiben können und unsere Autor*innen fair bezahlen können, brauchen wir Dich!
Melde dich an oder unterstütze andererseits jetzt mit einer Mitgliedschaft, um weiterzulesen
Zur Aboseite
