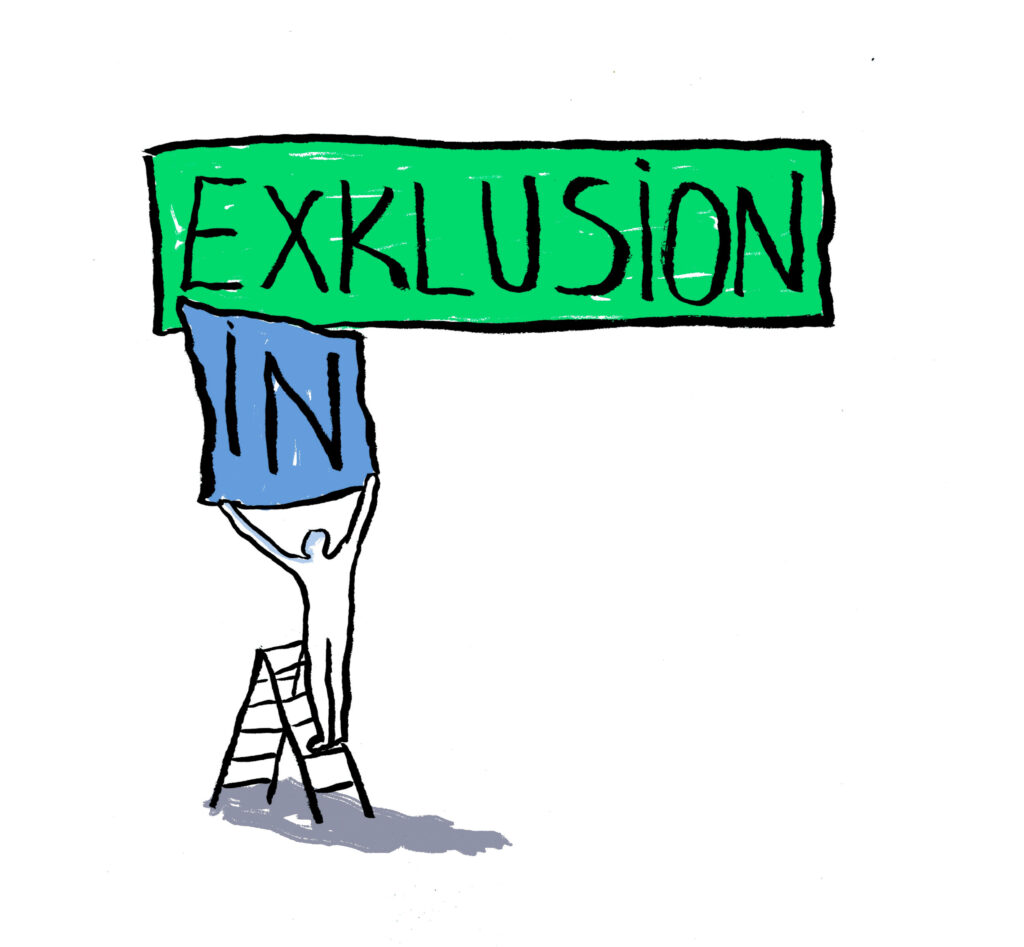Große Arbeit-Geber*innen in Deutschland müssen Menschen mit Behinderungen einstellen – oder Geld zahlen. Doch mit einem Trick können sie die Strafe umgehen. Wir zeigen erstmals genau, wie sich Firmen Millionen Euro sparen und wohin das Geld fließt.
Eine Recherche von: Kristina Kobl, Nikolai Prodöhl, Sabrina Ebitsch, Theodor Ahrens, Sabrina Winter, Natalie Sablowski, Emilia Garbsch
„Ich würde gerne in einer Bücherei arbeiten. Oder alten Menschen etwas vorlesen.“ Das wären gute Jobs für Ing Han Ong. Stattdessen sitzt der 45-jährige jeden Tag an einem weißen Holz-Tisch. Er faltet Papp-Schachteln, legt Nadel, Pflaster und Zettel für einen Vitamin-D-Test hinein. 200 Mal am Tag. Seit 4 Jahren. Ong arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Hamburg. Die Tests verpackt er für die Gesundheits-Firma Cerascreen. Dort verdient er 260 Euro Taschen-Geld im Monat, für rund 30 Stunden Arbeit jede Woche. Wie Ing Han Ong geht es vielen der über 300 Tausend Beschäftigten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Deutschland: Sie bekommen für ihre Arbeit sehr wenig Geld, viele leben unter der Armuts-Grenze.

Außerhalb des Systems der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen würde Ong mehr Geld verdienen und er wäre nicht von Sozial-Leistungen abhängig. Aber der allgemeine Arbeits-Markt ist nicht inklusiv. Es gibt nur wenige Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen. Und die wenigen Menschen mit Behinderungen, die eine Arbeit bekommen, stoßen am allgemeinen Arbeits-Markt auf weitere Hürden. Bauliche Barrieren, Unsicherheiten, Mobbing und Belästigung am Arbeits-Platz sind für viele Menschen mit Behinderungen Alltag.
Damit mehr Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeits-Markt kommen, gibt es in Deutschland eine Regel: Unternehmen mit 20 und mehr Mitarbeiter*innen müssen mindestens 5 Prozent ihrer Arbeits-Plätze an Menschen mit Behinderungen vergeben. Wenn Firmen zu wenige einstellen, müssen sie eine Strafe zahlen: Die Ausgleichs-Abgabe.
Die Regel soll Menschen wie Ong den Zugang zum deutschen Arbeits-Markt erleichtern. Doch die Mehrheit der Arbeitgeber*innen hatte im Jahr 2023 zu wenige Menschen mit Behinderungen eingestellt. Über 100 Tausend Arbeitgeber*innen mussten die Ausgleichs-Abgabe zahlen. Und das Gesetz erlaubt ihnen einen Trick, mit dem sie sich die Abgabe sparen können – oder sie sogar ganz umgehen.
Diese gemeinsame Recherche von andererseits, der Süddeutschen Zeitung und FragDenStaat zeigt zum ersten Mal genau, wie groß das Problem ist: Es geht um viele Millionen Euro, die eigentlich Menschen mit Behinderungen helfen sollen. Die aber stattdessen dafür benutzt werden, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu unterstützen – obwohl diese laut den Vereinten Nationen in ihrer jetzigen Form gegen die Menschen-Rechte verstoßen.
Wir haben viel über Werkstätten für Menschen mit Behinderungen herausgefunden. Wir zeigen, warum Werkstätten nicht zu den Menschen-Rechten von Menschen mit Behinderungen passen. Hier kannst du das in einfacher und leichter Sprache lesen.
Der Spar-Trick
Der Trick ist einfach: Wenn Firmen zu wenige Menschen mit Behinderungen eingestellt haben, können sie Aufträge an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen vergeben und dadurch einen Teil der Ausgleichs-Abgabe sparen. Bis zur Hälfte des Geldes, das Firmen für die Leistung der Werkstatt-Beschäftigten zahlen, können sie anrechnen.
Diesen Trick nutzen in Deutschland viele Arbeit-Geber*innen. Und sie sparen dabei viel Geld. Im Jahr 2022 waren es etwa 84 Millionen Euro. Arbeit-Geber*innen in Berlin sind dabei nicht erfasst. 84 Millionen Euro, mit denen das Werkstatt-System gefördert wurde – und nicht Maßnahmen, die Inklusion am Arbeits-Markt fördern. Von dem Geld hätte man rund 20 Tausend Büro-Plätze rollstuhl-gerecht umbauen können. Oder mehrere Tausend persönliche Assistenzen am Arbeits-Platz für ein ganzes Jahr bezahlen.
Am meisten sparen konnten im Jahr 2022 Arbeit-Geber*innen in Thüringen. In Bremen sparten sie am wenigsten durch den Spar-Trick. In Bundes-Ländern, in denen besonders viele Unternehmen sind, fließen so viele Millionen Euro direkt in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. In Bayern zum Beispiel mehr als 14 Millionen Euro im Jahr 2022.
Der kostenlose Newsletter für alle, die Behinderung besser verstehen wollen!
Wenn Arbeit-Geber*innen genug Werkstatt-Aufträge vergeben, müssen sie gar keine Abgabe zahlen. In Bayern konnten im Jahr 2022 so knapp 2500 Betriebe ihre Ausgleichs-Abgabe auf 0 Euro reduzieren. Das war fast jeder 10. Betrieb, der eigentlich die Ausgleichs-Abgabe hätte zahlen müssen.
Die Folge daraus ist nicht nur, dass die Firmen Geld sparen. Sondern auch, dass weniger Geld von Firmen in die Ausgleichs-Abgabe fließt. Die ist sowas wie ein Topf voll mit Geld, der für Inklusion ausgegeben werden soll. Wenn die Firmen weniger Geld zahlen, kann auch weniger Geld für Inklusion ausgegeben werden.

Ein Teil des Geldes aus der Ausgleichs-Abgabe geht an die Bundes-Agentur für Arbeit. Die bezahlt damit Unterstützung für Menschen mit Behinderungen am Arbeits-Markt. Das meiste Geld aus dem Topf bleibt bei den Integrations-Ämtern der einzelnen Bundes-Länder. Die bezahlen damit zum Beispiel Inklusions-Projekte oder Arbeits-Assistenzen. Ungefähr 3 Prozent davon gehen aber auch direkt an die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Das waren im Jahr 2022 knapp 15 Millionen Euro. Das heißt: Sogar mit dem Geld aus der Ausgleichs-Abgabe werden nicht-inklusive Strukturen gefördert.
Der Arbeits-Markt ist nicht inklusiv
Was die Firmen sich an Strafe sparen, sei für viele eine Kleinigkeit, sagt Ulrich Scheibner. Er hat früher die Bundes-Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten geleitet. Heute ist er einer der schärfsten Kritiker*innen des Systems der Werkstätten und der Ausgleichs-Abgabe. Er sagt: Die Gründe, warum Arbeit-Geber*innen den Trick nutzen, liegen nicht beim Geld. Stattdessen befürchten sie oft, es sei zu viel Aufwand, inklusive Arbeits-Plätze zu organisieren. Viele haben noch immer Vorurteile.
Das kann die Inklusions-Wissenschaftlerin Gudrun Wansing bestätigen: „Dass jemand eine sogenannte Schwer-Behinderung hat, heißt nicht automatisch, dass er oder sie nicht qualifiziert oder nicht leistungs-fähig ist. Leider wird das oft behauptet.“
So hat es auch Ing Han Ong erlebt. 5 Jahre lang hatte er einen Außen-Arbeits-Platz in einem Supermarkt in Hamburg. Das heißt: Er arbeitete auf dem allgemeinen Arbeits-Markt, war aber im Vergleich zu seinen Kolleg*innen offiziell in einer Werkstatt beschäftigt. Die zahlte ihm 395 Euro im Monat. Einen Arbeits-Vertrag bekam er nicht. Er räumte Regale ein und überprüfte, ob Lebens-Mittel noch haltbar waren. Nicht sein Traum-Job, sagt Ong, aber er hatte den Sprung aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in einen Betrieb geschafft. Bis die Chefin sich beschwerte, er würde zu langsam arbeiten. Erst sagte sie das hinter seinem Rücken zu anderen Kolleg*innen, erzählt Ong, später kritisierte sie ihn direkt. Es gehe nunmal nicht schneller, sagte Ong. „Die hat so ein bisschen Mobbing gemacht, also war gegen mich – gegen Behinderte“, sagt der 45-Jährige.

Nach 5 Jahren im Supermarkt kündigte er. Nicht nur wegen der Wochenend-Arbeit, sondern auch, weil er schlecht behandelt wurde. Es sei leider oft so, sagt Ong, dass die Menschen auf Menschen mit Behinderungen herumtrampeln. „Dabei sind wir alle nur Menschen und auch normale Menschen machen mal Fehler.“
Heute ist er zurück in der Werkstatt. Sein Taschen-Geld wird auch über Aufträge an Werkstätten finanziert. Dass Firmen von seiner täglichen Arbeit profitieren, findet Ong nicht gut: „Das fühlt sich schon ein bisschen nach Ausbeutung an.”
Das was Ong täglich in der Arbeit erlebt, hat großen Einfluss auf sein Selbstwert-Gefühl, sagt Gudrun Wansing: „Für Menschen mit Behinderungen macht es einen Unterschied, ob sie morgens durch ein Tor in eine Firma gehen und ein Teil einer Belegschaft sind, oder ob sie im Wohnheim mit dem Fahrten-Dienst abgeholt und in die Werkstatt gefahren werden.“
Und trotzdem: Weniger als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland stellen genug Menschen mit Behinderungen ein. Sogar öffentliche Firmen schaffen es nicht so richtig mit der Inklusion. Öffentliche Firmen arbeiten für alle Menschen in Deutschland. Doch auch sie sparen sehr viel Geld durch Aufträge an Werkstätten. In manchen Bundes-Ländern sparen öffentliche Firmen deutlich mehr als private, so zum Beispiel in Thüringen. Hier haben Betriebe des öffentlichen Dienstes durch Werkstatt-Aufträge im Jahr 2022 ein Viertel der Ausgleichs-Abgabe eingespart, private Betriebe weniger als ein Fünftel.
Die Bundes-Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten findet es nicht schlecht, dass man durch Werkstatt-Aufträge die Ausgleichs-Abgabe sparen kann. Sie sieht darin einen wichtigen „Nachteils-Ausgleich“ auf dem Markt.
Exklusion wird als Inklusion verkauft
Verpackungen, Zigaretten-Papier, Tank-Deckel – die meisten Menschen hatten schon Dinge in der Hand, die in einer Werkstatt von Menschen mit Behinderungen hergestellt wurden. Die wenigsten wussten es in dem Moment. Es gibt keine Pflicht, das auf dem Produkt zu vermerken.
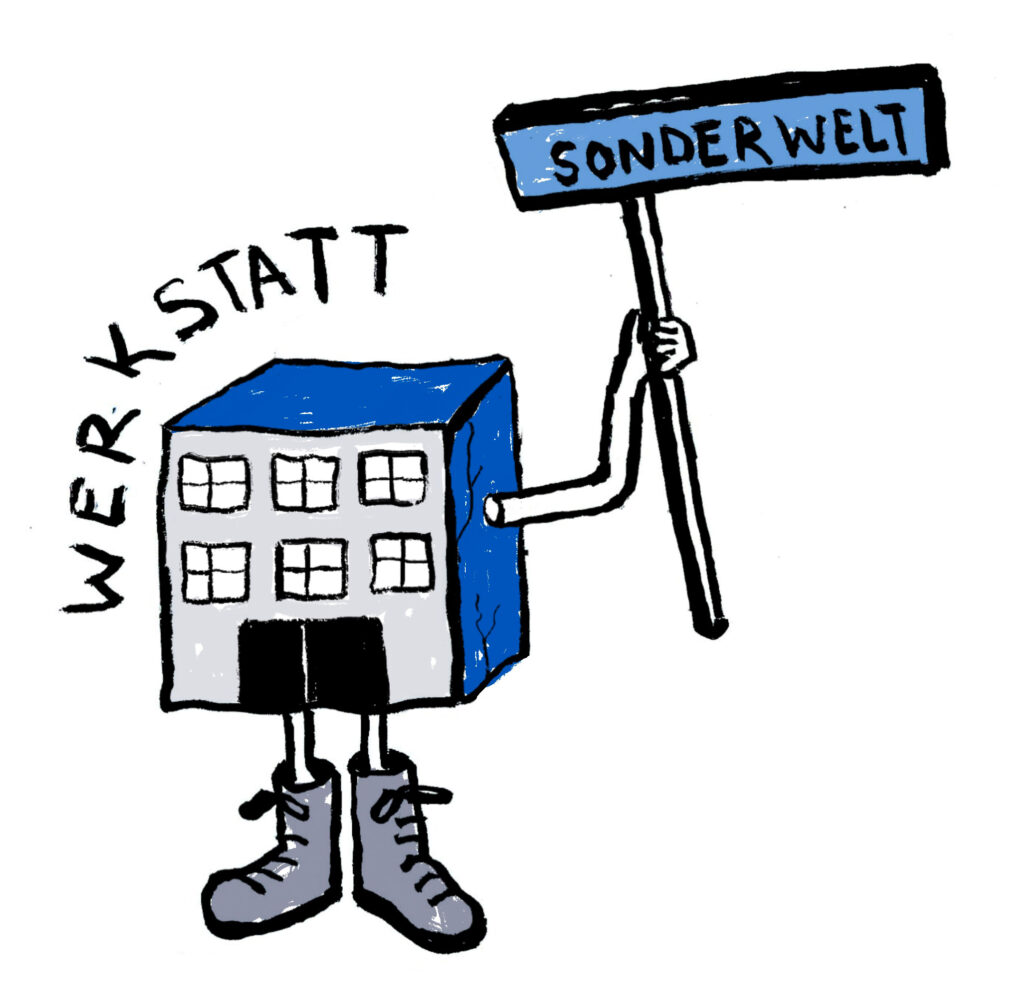
Dass so viele Firmen Aufträge an Werkstätten vergeben, liegt auch an einem Miss-Verständnis: Viele glauben, oder tun so, als wäre die Zusammen-Arbeit mit Werkstätten gut für die Inklusion. Die Gesundheits-Firma Cerascreen, für die Ong täglich Papp-Schachteln faltet, schreibt auf Anfrage, sie wollen damit zu einer inklusiven Arbeits-Welt beitragen: „Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und sehen sie als Beispiel dafür, wie Wirtschaft und Inklusion Hand in Hand gehen können.“
Und auch bei der Lufthansa, eine*r der größten Arbeit-Geber*innen in Deutschland, wird mit Inklusion geworben, die keine ist. Die Lufthansa Group stellte im Jahr 2024 zu wenig Menschen mit Behinderungen ein. „Die Lufthansa Group nutzt daher auch andere Wege der Förderung von Menschen mit Behinderungen, wie zum Beispiel die Vergabe von Aufträgen an Werkstätten für Behinderte“, schreibt uns ihre Presse-Stelle.
Statt genügend Menschen mit Behinderungen anzustellen, vergibt die Lufthansa Group also Aufträge an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in denen sie für ein Taschen-Geld arbeiten. Die Aufträge nutzen dem Unternehmen doppelt: Auf Anfrage schreibt die Lufthansa, ihre Gesellschaften würden die Möglichkeit nutzen, diese Werkstatt-Aufträge auf die Ausgleichs-Abgabe anzurechnen.
Und so geht die Inklusion auf dem Arbeits-Markt sehr schleppend voran. Eine Studie des Instituts für Arbeits- und Berufs-Forschung zeigt, dass manche Arbeitgeber*innen bewusst weniger Mitarbeiter*innen einstellen. Denn mehr Mitarbeiter*innen heißt auch: die Pflicht, mehr Mitarbeiter*innen mit Behinderungen einzustellen. Etwa bei einem Team aus 39 Personen nur 1 Person, bei einem Team aus 40 Personen bereits 2. In einer anderen Studie gaben 3 Viertel aller befragten Arbeit-Geber*innen an, dass sie keine passenden Bewerber*innen mit Schwer-Behinderungen finden.
Werkstätten-Kritiker Scheibner hat seine Zweifel: „Das ist in aller Regel eine Schutz-Behauptung. “Dass die Bewerber*innen angeblich nicht passen, liege an den Bedingungen im Unternehmen, sagt er. Die müsse man ändern. Jede Person könne gut arbeiten – wenn auf die persönlichen Voraussetzungen geachtet werde. Für Ong bedeutet das: Ruhe bei der Arbeit und eine klare Struktur der Arbeits-Schritte. Zu viele Aufgaben gleichzeitig bringen ihn durcheinander, sagt er. Ein genauer Plan würde ihm helfen, die Arbeit selbstständig zu erledigen.
Du glaubst an unsere Vision von inklusivem Journalismus? Dann unterstütze uns mit einem Abo!
Was die Politik ändern könnte
„Wir haben kein Rechts-Problem“, sagt Wansing. Es gäbe genug Maßnahmen zur Förderung von staatlicher Seite, nur ausreichend genutzt werden sie nicht. Etwa der barriere-freie Umbau eines Arbeits-Platzes und persönliche Assistenzen. Oder das „Budget für Arbeit“. Durch das „Budget für Arbeit“ können Werkstatt-Beschäftigte den Übergang in den allgemeinen Arbeits-Markt üben. Der Staat zahlt Unternehmen bis zu 3 Viertel des Gehalts der Beschäftigten. Außerdem wird eine Assistenz am Arbeits-Platz zur Verfügung gestellt. Doch weniger als 1 Prozent der Werkstatt-Beschäftigten wechseln tatsächlich aus Werkstätten in den allgemeinen Arbeits-Markt.
Dass die Werkstatt-Aufträge von Firmen dabei eine Rolle spielen könnten, hat auch die Politik erkannt. Die letzte Regierung in Deutschland wollte die Regel abschaffen, dass Firmen mit Werkstatt-Aufträgen Geld sparen können. Das hat aber nicht geklappt: Sie hat sich Ende 2024 frühzeitig aufgelöst. Die neue Regierung unter Bundes-Kanzler Friedrich Merz hat für das Thema bislang keinen neuen Plan. Auf Anfrage schreibt ein Sprecher des Ministeriums für Arbeit und Soziales: Es müsse nun geprüft werden, ob man sich mit den Maßnahmen in Zukunft beschäftigen wird. Unter anderem mit der geplanten Abschaffung der Regel zum Anrechnen der Aufträge.
Für Ing Han Ong wäre diese Veränderung nur ein Schritt in die richtige Richtung. Neben einer System-Änderung braucht es auch ein Umdenken. Er hat nach seinen schlechten Erfahrungen am allgemeinen Arbeits-Markt erstmal genug. Zurück würde er nur gehen, wenn es dort Menschen gäbe, die sich mit Behinderungen auskennen und Verständnis zeigen. Damit er nicht noch einmal so schlecht behandelt wird wie im Supermarkt. Bis dahin wünscht er sich vor allem einen höheren Lohn als die 260 Euro im Monat, die er in der Werkstatt verdient. „Davon wird das Essen noch abgezogen, leider“, sagt er. Sein Auftrag-Geber Cerascreen nennt die Arbeit in den Werkstätten auf Anfrage: „eine sinnvolle, fair entlohnte Beschäftigung“.
Geschrieben von
Kristina Kobl und Nikolai Prodöhl
Redaktion
Lisa Kreutzer
Illustration
Charlotte Wanda Kachelmann
Fact-Checking
Emil Biller
Daten
Natalie Sablowski,
Fin Hametner
Produktion
Lisa-Marie Lehner