Diese Recherche ist in Zusammenarbeit mit der Investigativ-Plattform DOSSIER entstanden.
Elsa ist elf Jahre alt und geht nicht in die Schule. Als Autistin nimmt sie die Welt anders wahr als die meisten Menschen. Zum Beispiel wird es ihr schnell zu laut, weil sie Geräusche nicht ausblenden kann. Und Elsa tut sich mit dem Kontakt zu Menschen schwer. Deshalb braucht sie bestimmte Bedingungen, um sich in der Schule wohlzufühlen. Bisher konnte keine Schule ein passendes Umfeld dafür bieten.
Dabei hat Elsa wie alle Kinder ein Recht auf Bildung. Ihre Stärken müssten gefördert werden. Aber in Österreich bekommt sie nicht, was ihr zusteht. Laut Expert·innen verschlechtert sich die Situation sogar. Sie sagen: Es fehlt an Bemühungen, das trennende System der Sonderschulen zu ändern. Dort lernen Schüler·innen mit Behinderungen unter sich. Sie bekommen zwar mehr Unterstützung im Unterricht. Doch Sonderschulen verletzen ihr Recht, gemeinsam mit Schüler·innen ohne Behinderungen zu lernen. Und selbst in Sonderschulen bekommen nicht alle die Unterstützung, die sie brauchen. Es fehlt an Geld, Lehrer·innen und Angeboten, die für alle funktionieren – und das auch auf Kosten von Elsas Bildung. Die Suche nach einem für sie geeigneten Platz ist für die ganze Familie ein ewiger Kampf.
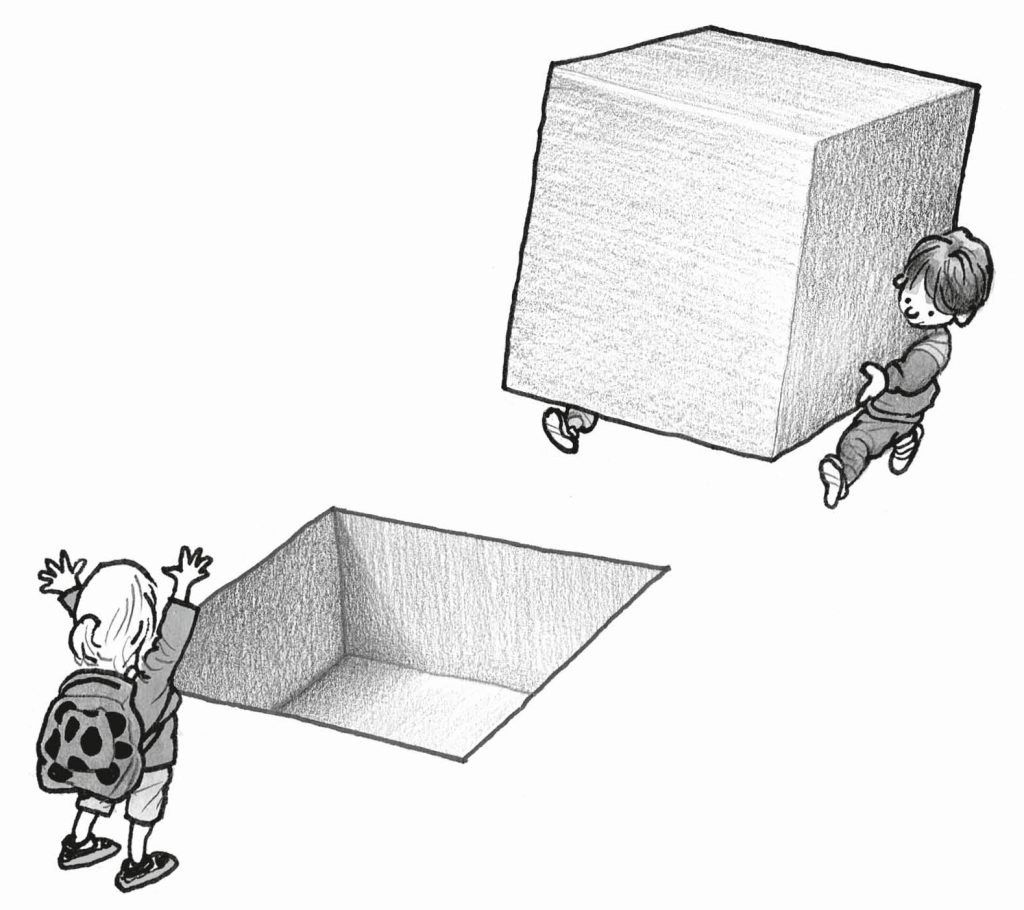
Was Schulen für Elsa bisher nicht bieten konnten, versuchen ihre Eltern seit Jahren auszugleichen. Ihre Namen wollen sie nicht öffentlich machen. Beide arbeiten im Sozialbereich. Für Elsa sind ihre Eltern ein sicherer Hafen. Sie setzen sich für sie ein, wenn andere sie nicht verstehen.
Und das ist oft so. Es gab bisher kein Schuljahr, in dem die Lernsituation für Elsa gepasst hätte. Mehrmals versuchte sie es an der Volksschule Föhrenwald in Wiener Neustadt. Und sie war auf der Montessori-Schule in Bad Sauerbrunn. »Wir starteten in Absprache mit der niederösterreichischen Bildungs-Direktion jedes Jahr einen neuen Schulversuch«, erzählt Elsas Vater, »es hat nichts für sie gepasst.« Denn was Elsa braucht, sind kleinere Klassen und mehr Zeit zur Eingewöhnung.
Der kostenlose Newsletter für alle, die Behinderung besser verstehen wollen!
Lebenslange Trennung
Laut Statistik Austria hatten im Schuljahr 2021/22 knapp 30.000 Schüler·innen in Österreich einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf. Mehr als ein Drittel besucht Sonderschulen. Dieser Anteil hat sich seit 2013 kaum verändert. Bei der Inklusion im Bereich Bildung gibt es also seit Jahren keinen Fortschritt.
»Im Gegenteil: Gerade in den vergangenen Jahren vermehren sich die Anzeichen für Rückschritte.« So steht es im »Sonderbericht Inklusive Bildung« des Monitoring-Ausschusses vom Juni 2023. Der Ausschuss ist unabhängig und kontrolliert, ob die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich eingehalten werden. »Schulen sind noch längst nicht barrierefrei«, sagt Tobias Buchner. Er ist Vorsitzender vom Monitoring-Ausschuss und forscht zu inklusiver Bildung an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.
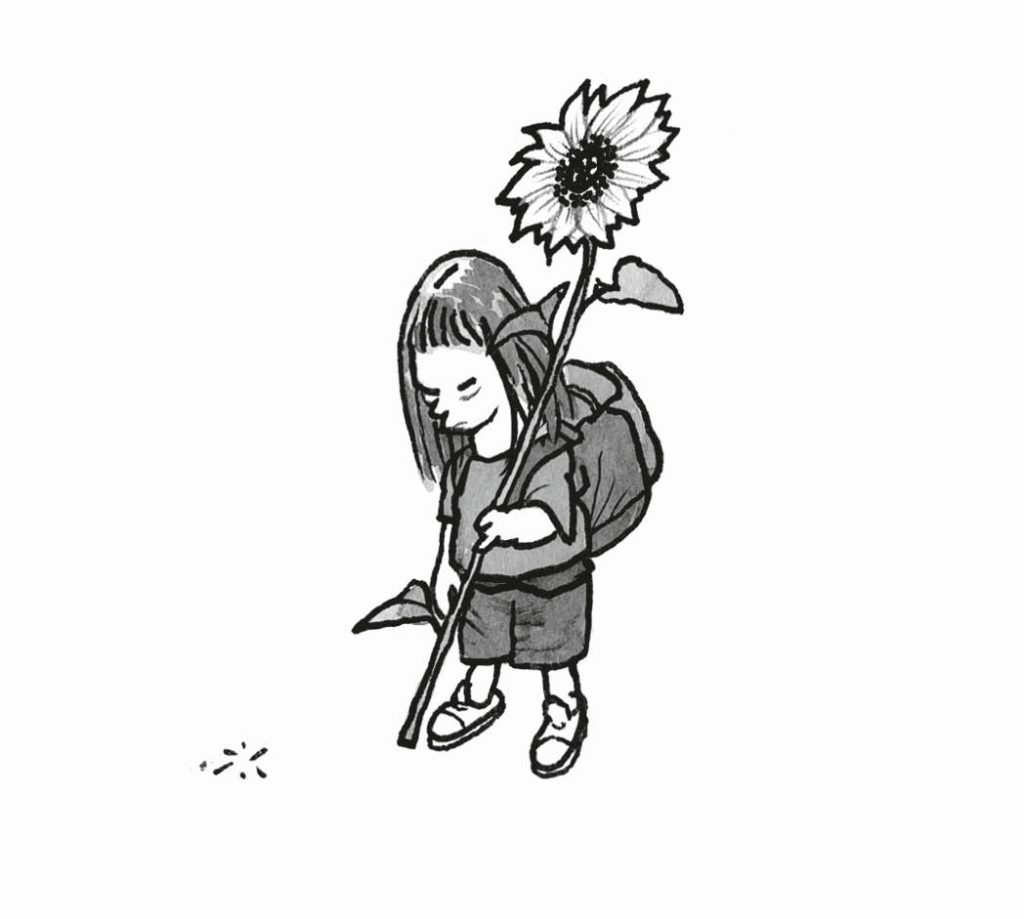
Buchner ist der Meinung: Mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf drückt man Schüler·innen einen Stempel auf. »Diese Zweiteilung der Schüler·innen wirkt sich insbesondere in Hauptfächern in scheinbar inklusiven Schulen so aus, dass die Sonder-Pädagog·innen mit den Schüler·innen das Klassenzimmer verlassen. Sie werden getrennt unterrichtet. Diese Unterscheidung setzt sich dann mitunter auch auf dem Schulhof fort«, sagt Buchner. Schüler·innen mit Behinderungen würden so häufig unter sich bleiben.
Auf manche wird weder in Sonderschulen noch in sogenannten Integrations-Klassen ausreichend Rücksicht genommen. So war es bisher auch bei Elsa. Ihr Autismus überfordere die Pädagog·innen oft, sagt ihre Mutter. Dadurch habe ihre Tochter viele schlimme Erfahrungen gemacht. Elsa erinnert sich daran, was sie in einer Schule erlebt hat: »Die Lehrer·innen waren nicht gut zu mir. Ich hatte die ganze Zeit Bauchweh, und mir ging es nicht gut. Die Kinder waren auch nicht so toll.«
Zu viel auf einmal
Elsa braucht Ruhe und Zeit. An neue Umgebungen muss sie sich langsam gewöhnen. Das ist wichtig, damit ihr nicht alles zu viel wird. Elsa hat nämlich PDA. Das ist die Abkürzung für Pathological Demand Avoidance. Auf Deutsch: Pathologische Anforderungs-Vermeidung. Das heißt: Ergibt etwas für Elsa keinen Sinn, bekommt sie Angst. »Das ist kein Spaß. Da geht es nicht darum, eine fünfte Kugel Eis haben zu wollen. Das ist wirklich absolute Panik«, erklärt ihre Mutter. Ihre Eltern respektieren Elsas Grenzen, in der Schule war das oft anders.
Große Klassen bedeuten für Elsa zu viele Reize. Zuletzt waren laut Statistik Austria durchschnittlich 20 Schüler·innen in einer Klasse. Nicht mitgerechnet sind dabei Sonderschulen. Dort sind die Klassen oft kleiner – aber trotzdem noch zu groß für Elsa.
»Wir haben uns das in den Schulen angeschaut«, erzählt ihr Vater. »Meistens sind über zehn Kinder und nur eine Lehrkraft in den Klassen.« Zweimal hatte Elsa eine Schulassistenz. Also eine Person, die sie im Unterricht begleitet hat. Trotzdem ist die Schulumgebung für Elsa zu viel.

Im Schuljahr 2015/16 wurde in Österreich ein Versuch gestartet, um sich vom Sonderschul-Unterricht zu entfernen: die inklusiven Modell-Regionen in Kärnten, der Steiermark und Tirol. Sie sollten Wege finden, um die Inklusion im Unterricht zu verbessern. Und so auch die Anzahl der Schüler·innen in Sonderschulen zu senken. Bis 2020 hätte der Versuch auf ganz Österreich ausgeweitet werden sollen. Stattdessen war 2018 Schluss. Seither hat es laut Tobias Buchner vom Monitoring-Ausschuss keine ernstzunehmenden Ansätze gegeben, um Inklusion in der Schule voranzutreiben.
Statt mehr Inklusion soll es mehr Sonderschulen geben. »Einzelne Bundesländer kündigten an, sonderschulische Angebote in den nächsten Jahren ausbauen zu wollen«, kritisiert der Monitoring-Ausschuss. Außerdem bezeichnet er bestehende Maßnahmen für inklusive Bildung als »nicht genügend«. Insgesamt zeige sich eine andauernde »Verletzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen im Bereich Bildung«.
Geld regiert das Schulsystem
Ein weiteres Ziel der inklusiven Modell-Regionen war, das Geld für die Schulen fairer zu verteilen. Eigentlich verspricht das Gesetz für Schüler·innen mit erhöhtem Förderbedarf passende Unterstützung im Unterricht. Aber: Das Bildungs-Ministerium geht bei der Finanzierung des Lehrpersonals davon aus, dass nur eines von 27 Schulkindern auf allgemein bildenden Schulen einen Förderbedarf hat. Laut Statistik Austria ist es aber ein Kind von 20. Die Politik rechnet also mit weniger Schüler·innen mit Förderbedarf, als es tatsächlich gibt.
Das Bildungs-Ministerium schreibt dazu auf Anfrage, dass es die gesetzlich vorgeschriebenen Plan-Lehrstellen finanziere. Zusätzlich würden pro Jahr bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung stehen, die auch für die Förderung von Schüler·innen in den Ländern ausgegeben werden können. Laut Monitoring-Ausschuss fehlt es trotzdem an Geld, weil die tatsächlichen Kosten nicht übernommen werden. Er nennt das Geldproblem in seinem Bericht »chronische Unter-Finanzierung«.
Keine Rücksicht auf Bedürfnisse
Darunter leidet der Unterricht. Es gibt zum Beispiel zu wenige speziell ausgebildete Lehrer·innen. Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen ist »ernsthaft besorgt« darüber. Auch der »Sonderbericht Inklusive Bildung« vom Monitoring-Ausschuss kritisiert das. Außerdem werden zu wenige Lehrer·innen finanziert. Das führt zu Überlastung und Überforderung. Auch deswegen wollen laut dem Bericht immer weniger Menschen in inklusiven Klassen unterrichten.
So fehlt es zunehmend an Personal, das Schüler·innen wie Elsa unterrichten kann. Entsprechend verzweifelt sind ihre Eltern: »Jedes Jahr bekommen wir ein neues Angebot, weil Elsa ein Recht auf einen Schulplatz hat«, sagt ihr Vater. Aber die bisherigen Angebote haben nie gepasst. Denn die Schulbehörde entscheidet, welcher Schulplatz ihrer Ansicht nach geeignet ist. Wegen der Schulpflicht muss dieser dann auch angenommen werden.
»Das hieß für mich: Elsa wieder gegen die Wand rennen lassen zu müssen«, sagt ihr Vater. Auch die Volksanwaltschaft habe in dem Fall nichts machen können. Sie kontrolliert die öffentliche Verwaltung, also auch Schulen. Auf Anfrage erklärt ein Mitarbeiter, dass sich die Volksanwaltschaft nicht zu Einzelfällen äußere. Aber er bestätigt: Es müsse nur ein Schulplatz zugewiesen werden, der grundsätzlich auf Schüler·innen mit Förderbedarf ausgelegt ist. Auf konkrete Bedürfnisse müsse nicht Rücksicht genommen werden. Da sei man auf den »guten Willen« der Bildungs-Direktionen angewiesen.
Die Folge: Elsa muss den Schulplatz annehmen, den ihr die Bildungs-Direktion zuteilt. Auch wenn sehr wahrscheinlich ist, dass er nicht passend ist. »Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr das total hoch anrechne, dass sie immer wieder offen dafür ist«, sagt ihre Mutter. Vor allem weil Elsa in der Schule viele belastende Erlebnisse hatte, die sie bis heute beschäftigen.
Du glaubst an unsere Vision von inklusivem Journalismus? Dann unterstütze uns mit einem Abo!
Hoffen auf eine bessere Lösung
»Irgendwann zogen wir die Notbremse und nahmen sie aus der Schule in den häuslichen Unterricht«, sagt ihre Mutter. »Mal war ich motiviert, mal sowas von schlecht drauf«, erinnert sich Elsa an den Unterricht zu Hause. Mit ihrem Vater lernte sie fleißig für eine Prüfung, die sie am Ende des Schuljahres machen musste.
Den Eltern war trotzdem bald klar: Die Prüfungs-Situation wird für Elsa nicht funktionieren. Denn ihre Tochter kann nicht immer sprechen. Zum Beispiel in ungewohnten Situationen wie Prüfungen. Die Familie suchte bei der Bildungs-Direktion Hilfe. Es gab zwar Anpassungen, aber am Prüfungstag hatte Elsa zu wenig Zeit. Sie hat nicht bestanden.
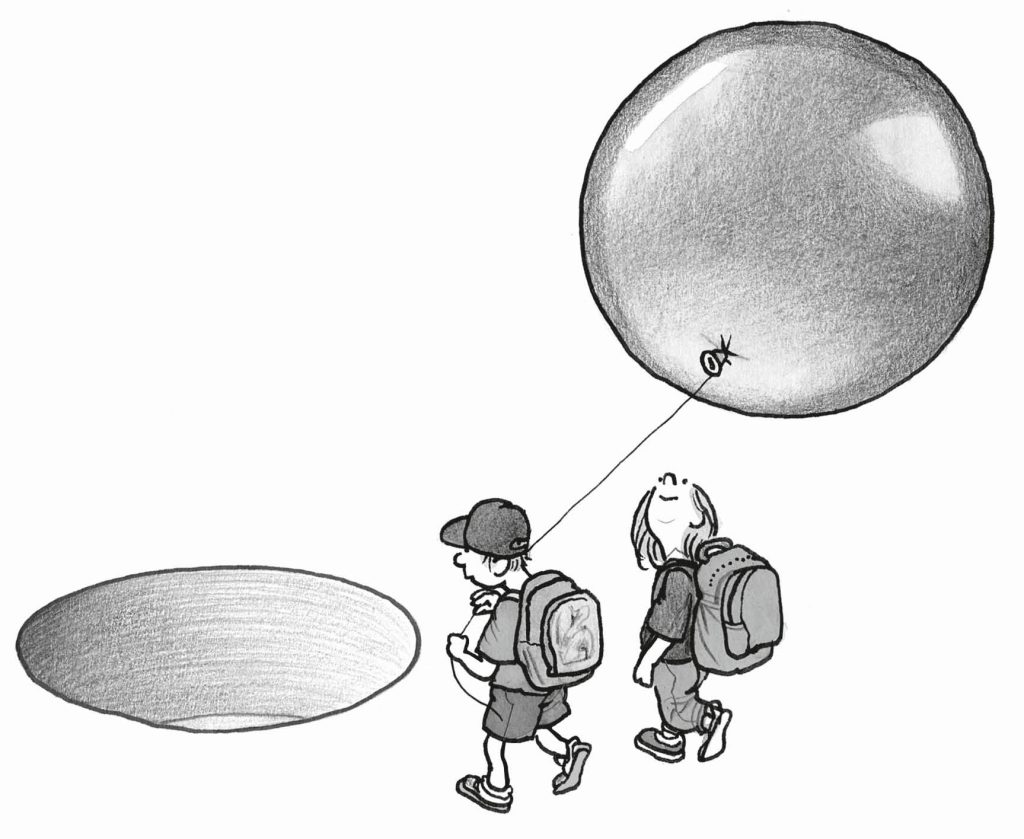
Was sagt die zuständige Bildungs-Direktion Niederösterreich zu Elsas Situation? Eine Sprecherin sagt:
Es gebe »ständigen Austausch« mit Elsas Eltern. Die Behörde habe »alles unternommen, was in ihrer Kompetenz liegt«. Das »übergeordnete Ziel« sei, dass Elsa die Schule besucht. Man arbeite deswegen an »einer sehr individuellen Lösung«.
Vor einiger Zeit hörte Elsas Mutter von einem Bildungs-Angebot des Landes Niederösterreich. Der Name: »Hin und Weg«. Es ist für Jugendliche, die als »nicht beschulbar« gelten. Das sind zum Beispiel Schüler·innen mit »emotionalen, psychischen und sozialen Auffälligkeiten«. Elsas Eltern wollten schon länger, dass sie dieses Angebot ausprobiert. »Dafür musste davor alles andere probiert werden. Aber jetzt ist es so weit: sechs Schulversuche und viele Traumata später«, sagt ihre Mutter.
Seit Anfang des Schuljahres besucht eine Lehrerin von »Hin und Weg« Elsa regelmäßig zu Hause. Sie haben langsam Vertrauen aufgebaut, Ausflüge gemacht und Lernziele festgelegt. Das funktioniert gut für Elsa. Ihre Teilnahme ist allerdings vorerst auf ein Jahr begrenzt. Ob sie danach weitermachen darf, ist unklar.
- November, 2023
Geschrieben Von
Theresa-Marie Stütz
In Zusammenarbeit mit
Redaktion
Lisa Kreutzer
Illustrationen
Gerhard Haderer
Inklusiver, kritischer und gleichberechtigter Journalismus ist wertvoll
andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Bei uns arbeiten Journalist*innen mit und ohne Behinderung gemeinsam – damit wir unabhängig bleiben können und unsere Autor*innen fair bezahlen können, brauchen wir Dich!
Melde dich an oder unterstütze andererseits jetzt mit einer Mitgliedschaft, um weiterzulesen
Zur Aboseite
