Diese Recherche ist in Zusammenarbeit mit der Investigativ-Plattform DOSSIER entstanden.
Silvia Pospischil hat eine verantwortungsvolle Rolle. Sie arbeitet als Ärztin in der »Gesundheits-Straße« der Pensionsversicherungs-Anstalt (PVA). Dort beurteilt sie gemeinsam mit Kolleg·innen, ob Menschen »arbeitsfähig« sind oder nicht. Pospischils Urteil fließt in einen Bescheid ein und hat weitreichende Folgen: Wer als arbeitsunfähig eingestuft wird, wird nicht mehr vom Arbeitsmarkt-Service (AMS) unterstützt. Wie lange dauert die Untersuchung? »Ungefähr eine halbe Stunde«, sagt Pospischil. Manchmal sind es auch nur zehn Minuten, berichten Betroffene.
Es gibt dabei Probleme: Kaum jemand scheint die Kriterien zu kennen, nach denen Arbeits-Fähigkeit festgestellt wird. Betroffene erzählen von Machtmissbrauch und Einschüchterung. Und insbesondere junge Menschen mit Behinderungen leiden unter den Folgen eines Bescheids. Oft haben sie noch keinen Anspruch auf Berufsunfähigkeits-Pension. Ihnen bleibt damit nur die Mindestsicherung oder das Arbeiten in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderungen – ohne Aussicht auf Gehalt oder Pension. Sie bleiben vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Behinderten-Verbände bezeichnen den Bescheid daher als »Arbeitsverbot«.
Jedes Jahr schickt das AMS tausende Menschen zur »Feststellung der Berufs-Fähigkeit« in die PVA.
Die meisten wollen laut AMS und PVA als »arbeitsunfähig« anerkannt werden. Viele von ihnen haben eine lange Kranken-Geschichte hinter sich. Aber nicht nur: Das AMS schickt auch junge Menschen zu der Untersuchung. 2022 waren es insgesamt rund 6.000 Personen. Bei 18,5 Prozent wurde eine Arbeits-Unfähigkeit festgestellt. Das sind mehr als tausend Menschen. Wie viele davon eine Behinderung haben, erfasst die PVA nicht.
Die Untersuchung ist gesetzlich verpflichtend. Wer sich weigert, verliert Arbeitslosen-Geld oder Notstandshilfe. Außerdem können nur »arbeitsfähige« Menschen die Förder-Programme zur Arbeits-Integration nutzen, etwa das Jugendcoaching oder die Arbeits-Assistenz. Und es ist schwer, den Status »arbeitsunfähig« wieder loszuwerden.
Die Vereinten Nationen kritisieren die österreichische Praxis in ihrem aktuellen Bericht scharf. Die rein medizinische Beurteilung gilt längst nicht mehr als zeitgemäß. Arbeits-Minister Martin Kocher (ÖVP) sagt im Interview, dass er nicht weiß, nach welchen Kriterien jemand in die Gesundheits-Straße geschickt wird.
Wir haben bei der PVA, wo die Untersuchung stattfindet, nachgefragt. Beim Video-Interview sind die stellvertretende Chefärztin Brigitte Preier, die Ärztin Silvia Pospischil, eine Psychiaterin und eine Sprecherin dabei. Viel Licht ins Dunkel bringen sie nicht. Zu Beginn der Untersuchung gebe es ein kurzes Gespräch, Befunde würden gesichtet und allgemeine medizinische Tests durchgeführt. Der Ablauf sei immer gleich. »In dieser Beurteilung ist alles abgebildet, körperliche und geistige Einschränkungen. Das wird alles beurteilt am Ende des Gutachtens«, erklärt Preier.
Nikolai Prodöhl (»andererseits«) hat das Gespräch so zusammengefasst:
Jeder bekommt die gleiche Untersuchung, unabhängig davon, ob es körperliche oder geistige Einschränkungen gibt. Eine Person gilt als arbeitsunfähig, wenn sie weniger als 20 Stunden in der Woche arbeiten kann. Bei der Untersuchung wird nicht festgestellt, für welche Arbeit jemand infrage kommen könnte. Die Personen können das Gutachten nicht lesen, bevor es an das AMS übermittelt wird. Die PVA darf das Gutachten nicht außer Hand geben, weil sie Auftrag-Nehmerin des AMS ist. Beim Gutachten gibt es häufig Beschwerden. Zum Beispiel, dass sie nicht nett mit einer oder einem umgehen. Die Beschwerden gehen dann zum AMS. Nach dem Gutachten kann das AMS einen Bescheid ausstellen. Im Jahr 2024 soll ein neues Gesetz kommen: Nur mehr Menschen, die älter als 25 sind, sollen als arbeits-unfähig eingestuft werden dürfen. Auf unsere Frage, wie viel Prozent der Menschen mit Behinderungen als arbeitsunfähig eingestuft werden, haben sie uns keine Antwort gegeben. Sie gaben an, keine Zahlen zu kennen oder nicht dafür zuständig zu sein. Wir wissen jetzt nicht viel mehr als vor dem Interview.
Der kostenlose Newsletter für alle, die Behinderung besser verstehen wollen!
Zum Chefarzt zitiert
Wir konnten mit Menschen sprechen, die bei der Untersuchung in der PVA waren. Sie berichten von Problemen, eine Begleitperson mitbringen zu dürfen. Aktuelle Befunde würden ignoriert. Vor allem schildern sie Stress-Situationen und fühlen sich von den Gutachter·innen schlecht behandelt.
Bei Sabine wurde vor etwas mehr als zwei Jahren Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert. Das ist eine chronische entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Etwa ein Drittel der MS-Betroffenen bleibt arbeitsfähig. Auch die 36-Jährige möchte arbeiten. Aus Angst vor Nachteilen bittet sie, anonym zu bleiben. Ihre Behinderungen wurden vom Sozialministerium-Service mit 60 Prozent anerkannt. 2022 stellte sie bei der PVA einen Antrag auf vorübergehende Berufsunfähigkeits-Pension. Das ist ein »Reha-Jahr«, um wieder arbeitsfähig zu werden. Sabine musste deshalb zur Untersuchung bei der PVA.
Die Probleme begannen schon am Eingang: Obwohl in ihrem Behinderten-Pass eine Begleitperson eingetragen ist, sollte ihr Freund draußen warten. Nach längerer Diskussion durfte er mit. Der Arzt unterbrach jedoch die Untersuchung, weil ihr Freund während der Untersuchung mitschreiben wollte.
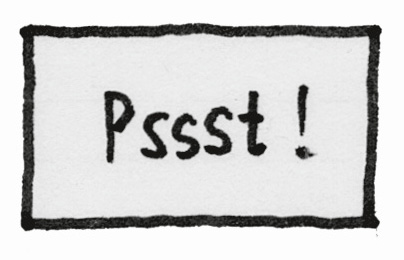
»Wir wurden zum Chefarzt zitiert. Der erklärte uns, entweder mein Freund hört auf mitzuschreiben oder die Untersuchung gilt als verweigert«, sagt Sabine Sie habe »nur mehr geheult«. Bei einem weiteren Termin fand eine psychologische Untersuchung statt. »Ich musste Heftklammern zählen, Tests am PC machen, Fragebogen ausfüllen.« Als »roboterhaft« und »sehr, sehr kalt« beschreibt sie den Umgang der PVA mit Klient·innen. »Es findet kein Dialog statt. Man gibt die Würde an der Tür ab.«
Monate später bekam sie den Bescheid: Ihr Antrag wurde abgelehnt. Im Gutachten wird angedeutet, Sabine übertreibe. Sie hat keinen Anspruch auf medizinische oder berufliche Rehabilitation. Für den Wiedereinstieg sucht sie jetzt eine Teilzeitstelle. Beim AMS sei ihr erklärt worden, auf ihre Behinderungen könne nur Rücksicht genommen werden, wenn die PVA sie bestätigt.
»Routinemäßige Fließband-Abfertigung«
Auch Jakob, Mitte 30, beschreibt Probleme mit der PVA. Er möchte anonym bleiben, sein Verfahren läuft noch. Jakob wurde vom Beruflichen Bildungs- und Rehabilitations-Zentrum bereits als arbeitsunfähig eingestuft. Doch das AMS akzeptierte das Gutachten nicht. Er musste in die Gesundheits-Straße. »Die gesamte Untersuchung dauerte zehn Minuten«, schreibt er in einer E-Mail und bezeichnet sie als »routinemäßige Fließband-Abfertigung«. Ein Facharzt war – obwohl vom AMS gefordert – nicht dabei.
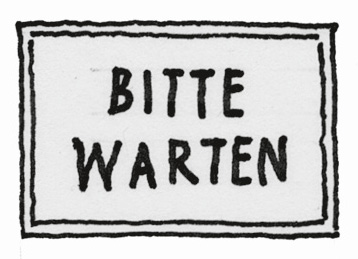
Sechs Wochen später las ihm sein AMS-Berater das Gutachten der PVA vor: Jakob sei völlig gesund und dürfe gesundheitliche Probleme in seinen Bewerbungen nicht erwähnen. Das AMS vereinbarte für ihn eine neue Untersuchung in der Gesundheits-Straße und forderte wieder einen Facharzt. Beim zweiten Termin stand aber wieder derselbe Allgemein-Mediziner vor ihm wie beim ersten Mal. Wieder habe die Untersuchung nur zehn Minuten gedauert. Wieder steht im Gutachten, Jakob sei »völlig arbeitsfähig« – dieses Mal mit dem Zusatz, er sei »aggressiv«, weil er darauf bestanden habe, dass medizinische Bewertungen von anderen Ärzt·innen miteinfließen, erzählt er. Das AMS hat ihm jetzt Zeit gegeben, ein privates Gutachten erstellen zu lassen.
»Massive Einschüchterungen«
Viele Vorwürfe finden sich auch in einer Umfrage der Arbeiterkammer Oberösterreich aus dem Jahr 2018: Aktuelle Befunde würden ignoriert, die Rede ist von »respektlosem Umgang« und »massiven Einschüchterungen«. Am Ende stehe oft Aussage gegen Aussage, »weil Begleit-Personen unerwünscht sind«, heißt es weiter. Bei mehr als einem Drittel der 300 Betroffenen habe die Untersuchung maximal 15 Minuten gedauert – 15 Minuten, die über die Zukunft junger Menschen entscheiden können.
Die PVA hat zu den Vorwürfen eine Stellungnahme geschickt: Begleit-Personen seien gestattet, »solange sie den Fortgang der Untersuchung und Begutachtung nicht stören«. Das Mitschreiben ist laut Pressestelle der PVA nicht untersagt. Im Gutachten von Sabine steht jedoch, dass der Arzt deswegen die Untersuchung nicht weiterführen wollte.
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, sich gegen den Bescheid zu wehren. »Eine neuerliche Begutachtung bei einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin aufgrund von ›Unzufriedenheit mit der Begutachtung‹ ist grundsätzlich nicht möglich«, schreibt die Sprecherin der PVA. Betroffene können beim AMS Beschwerde einlegen oder sich an das Bundesverwaltungs-Gericht wenden. Den Weg zum Gericht wählen aber nur sehr wenige Menschen. In den vergangenen zwei Jahren waren es laut AMS nur 16 Personen.
Die Klient·innen erfahren in der Gesundheits-Straße nichts. Erst der AMS-Berater oder die AMS-Beraterin bespricht das medizinische Gutachten mit ihnen. Das Gutachten könne »auf Wunsch« vom AMS ausgehändigt werden, heißt es dort.
Du glaubst an unsere Vision von inklusivem Journalismus? Dann unterstütze uns mit einem Abo!
»Arbeitsunfähig« , weil behindert?
Behinderten-Verbände kritisieren seit Jahren, dass es bei der Feststellung nicht immer fair zugehe. 2018 brachte eine Bürger-Initiative das Thema »Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch die österreichische Gesetzgebung« zur Diskussion in den Nationalrat ein. Getragen wurde die Initiative vom Tiroler Verein Vianova. Dort sind Fälle bekannt, dass Menschen mit Behinderungen vom AMS zur Feststellung ihrer Arbeits-Fähigkeit in die Gesundheits-Straße geschickt wurden, obwohl sie zuvor berufstätig waren.
Ein Grund dafür könnte sein, dass die Vermittlung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen aufwendiger ist als bei anderen: Mit 212 Tagen dauert es im Schnitt doppelt so lange, bis sie eine Stelle finden. 2022 waren in Österreich mehr als 76.000 Personen mit »gesundheitlichen Vermittlungse-Einschränkungen« beim AMS als arbeitssuchend gemeldet. Rund 18 Prozent davon haben laut AMS eine Behinderung. Bei der Gruppe der unter 25-Jährigen ist es mehr als ein Viertel – weit mehr als in den anderen Altersgruppen.
Dass in Österreich schon Jugendliche als »arbeitsunfähig« eingestuft werden können, empört die Vereinten Nationen. In ihrem Bericht wird »die ausgrenzende Wirkung« der Untersuchung betont und dass eine Behinderung rein medizinisch beurteilt wird. Im Juni 2023 traten Arbeits-Minister Martin Kocher (ÖVP) und Sozial-Minister Johannes Rauch (Grüne) mit Markus Neuherz vom Österreichischen Behinderten-Rat vor die Kameras. Künftig soll die Feststellung erst im Alter von 25 Jahren erfolgen. Bis dahin soll das AMS bei der Arbeitssuche unterstützen. Der Gesetzes-Entwurf wurde von Behinderten-Verbänden begrüßt. Das AMS lehnte ihn ab.
In einer inoffiziellen Stellungnahme listet der AMS-Vorstand auf 19 Seiten auf, warum der Vorschlag »unsachlich, unsystematisch und unzulänglich« sei.
In dem Entwurf wird von rund hundert Personen ausgegangen, die vom AMS pro Jahr zusätzlich betreut werden müssten. Aber das AMS schätzt die Zahl mit 3.000 bis 5.000 viel höher. Dafür brauche es mehr Personal und Budget. Beides ist in dem Entwurf nicht vorgesehen. »Eine sinnvolle Umsetzung des Vorhabens mit 1. Jänner 2024 ist aus Sicht des AMS kaum zu schaffen«, bekräftigte der Vorstand im September.
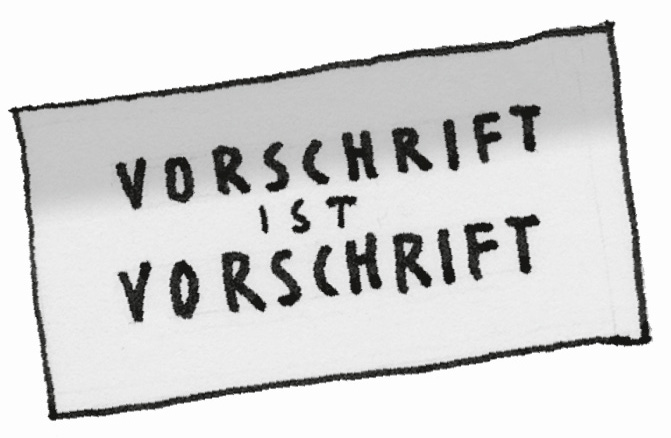
Es ist bezeichnend, dass für die Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen kein zusätzliches Geld freigemacht wird. Und dass nicht einmal bei den höchsten Stellen klar ist, wie viele Menschen betroffen sind. Der Ball liegt jetzt bei den Ministerien, noch in diesem Jahr soll ein neuer Entwurf präsentiert werden. Einzig die Pensionsversicherungs-Anstalt sieht sich von alledem nicht betroffen. Die geplante Gesetzes-Änderung »bedeutet in dieser vorgesehenen Fassung keine Änderungen für die PVA in der Praxis beziehungsweise Vollziehung«, heißt es dazu von der Pressestelle.
- November, 2023
Geschrieben Von
Julia Herrnböck
und von
Nikolai Prodöhl
Redaktion
Lisa Kreutzer
Illustrationen
Gerhard Haderer
Inklusiver, kritischer und gleichberechtigter Journalismus ist wertvoll
andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Bei uns arbeiten Journalist*innen mit und ohne Behinderung gemeinsam – damit wir unabhängig bleiben können und unsere Autor*innen fair bezahlen können, brauchen wir Dich!
Melde dich an oder unterstütze andererseits jetzt mit einer Mitgliedschaft, um weiterzulesen
Zur Aboseite

